Verstehen. Verinnerlichen. Leben.
Die Individualpsychologie
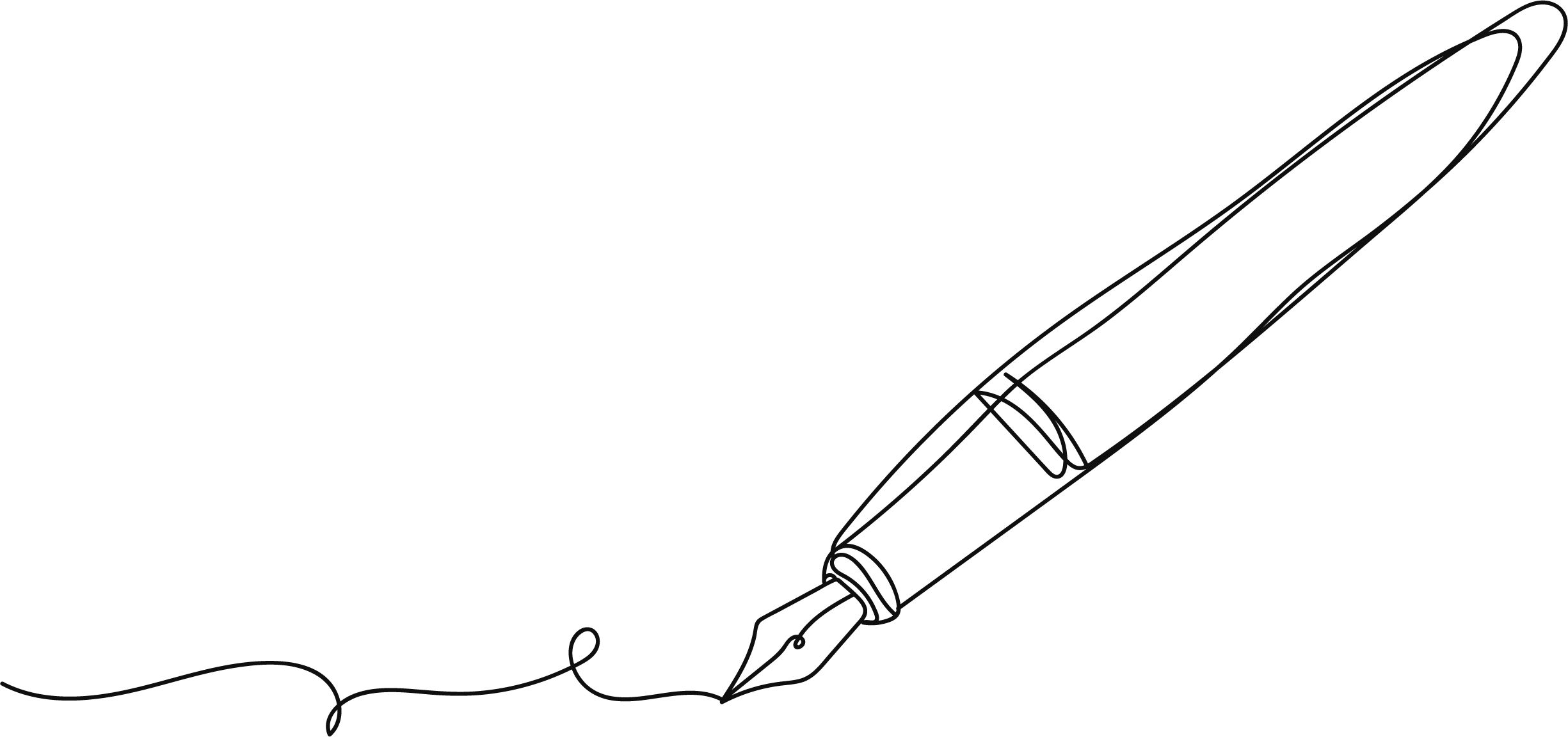
Der universelle
Gedanke der
Individualpsychologie
„Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt.“ (Johannes von Salisbury)
Alfred Adler ist ein Gigant der Psychologie. Ein Riese, der es uns ermöglicht heute weiterzuschauen, als wir es ohne ihn könnten. Nicht weil wir besser, intelligenter oder weiterentwickelt wären, sondern weil wir auf seinen Schultern stehen. Mit unserer heutigen Brille auf die Welt und auf das Individuum blicken – und verstehen. Nur, weil eine Erkenntnis schon vor ein paar Jahrzehnten das Licht der Welt erblickte, bedeutet dies nicht, dass sie heute keine Relevanz mehr hätte. Überholt oder nicht modern genug sei.
Die Individualpsychologie ist universell. Sie eint nicht nur geografisch die Menschen, sondern über Raum und Zeit hinweg. Das mag für unseren Verstand, unser Ego, – sehen wir uns doch selbst als Krone der Schöpfung an – zunächst verwirrend erscheinen. Aber da das Minderwertigkeitsgefühl dem menschlichen Geiste entspringt, ist es nur konsequent dies auch für vergangene Generationen und über alle Kulturen hinweg anzunehmen.
Allein dieser Gedanke zeigt, wie sehr wie uns doch eigentlich als Teil einer großen Menschheitsfamilie verstehen und anerkennen müssten. Ganz egal in welche Kultur, in welches Sozialgefüge, ja sogar in welche Zeit wir hineingeboren wurden. Das Minderwertigkeitsgefühl, der Kern aller Kompensation unserer erdachten und konstruierten Unzulänglichkeit und die damit verbunden Probleme, war schon immer da. Die Ausprägung dessen kann variieren, aber nicht die Existenz als solches.
Der Kern all
unserer Probleme
Dieser universelle Gedanke stammt von Adler selbst. Schrieb er doch:
„So wie der Säugling in seinen Bewegungen das Gefühl der Unzulänglichkeit verrät, das unausgesetzte Streben nach Vervollkommnung und nach Lösung der Lebensanforderungen, so ist die Geschichte der Menschheit als die Geschichte des Minderwertigkeitsgefühls und seiner Lösungsversuche anzusehen.“
Somit postulierte Adler, dass der Mensch und sein Handeln bestimmt werden durch die Kompensation dieses, uns allen eigenen, Minderwertigkeitsgefühls. Aber gerade dieses Minderwertigkeitsgefühl, des Gefühl der Unzulänglichkeit, des Unwohlseins definiert unser Menschsein.
„Menschsein heißt, ein Minderwertigkeitsgefühl zu besitzen, das ständig nach seiner Überwindung drängt,“ so Adler.
Wie entsteht aber dieses Minderwertigkeitsgefühl? Der Schlüssel liegt laut Adler in der Kindheit. Zweifellos ist das Kind in der frühen Kindheit noch nicht in der Lage, das zu können, was Erwachsene oder älteren Geschwister können. Dies erzeugt das Gefühl von Minderwertigkeit. Natürlich kann jeder Mensch dies im Laufe seines Lebens irgendwann ausgleichen. In der frühkindlichen Phase eines jeden Menschen stellt sich jedoch die Fiktion ein, es wäre besser einen anderen Weg zur Kompensation dieses unangenehmen Gefühls zu wählen, statt die gewünschten und noch nicht beherrschten Fähigkeiten in einem langwierigen Prozess zu erlernen. So entsteht die Fiktion des Höher-Strebens.
Die Minderwertigkeitsgefühle sind als im Grunde eingebildete Unfähigkeiten. „Der neurotische Charakter ist unfähig, sich der Wirklichkeit anzupassen, denn er arbeitet auf ein unerfüllbares Ideal hin“, so Adler. Und genau darin liegt der Kern all unserer Probleme, seien sie individueller oder gesellschaftlicher Natur.
Unser
Ego-Verstand
Das Minderwertigkeitsgefühl, das Gefühl der Unvollkommenheit, des Mangels, ist jedoch Teil unseres Ego-Verstandes. Wenn es uns bewusst ist, ist es ein Gefühl der Unzulänglichkeit, eines mangelnden Selbstwertgefühls. Weniger bewusst ist es ein Gefühl des Haben-Wollens, der Bedürftigkeit. Die zwanghafte Ego-Befriedigung, die Identifikation mit den verschiedensten Dingen, das nicht endende Streben nach Besitz, Geld, Erfolg, Macht, Anerkennung, was jedoch nicht dauerhaft befriedigt werden kann, führt zum Gefühl des Unglücklich-Sein.
Solange wir uns also mit unserem Verstand oder den Gefühlen, oder beidem, unbewusst identifizieren, sind wir unglücklich. Erst wenn wir uns dieser Identifikationen bewusstwerden, werden wir im Bewusstsein ruhend diese Dinge ertragen. Es ist wie es ist, erst die Bewertungen des Verstandes machen das Unglück daraus.

Zwei Seiten
einer Medaille
Die Rolle
der Gemeinschaft
„Wir können uns in nur vierzehn Tagen von unseren Depressionen befreien, wenn wir uns nur jeden Tag überlegen, wie wir anderen helfen können.“ Für unser Ego erscheinen diese Worte von Adler zunächst befremdlich. Für ihn liegt jedoch der Kern der Neurose im Mangel an Gemeinschaftsgefühl. Die Erfüllung der drei Lebensaufgaben (Ich-Du Beziehung, Beruf und Berufung und das Leben für und in der Gemeinschaft), die den Sinn unseres Lebens darstellen, ist jedoch nur in Gemeinschaft zu erreichen. Dieses, für ein zufriedenes Leben notwendige Gemeinschaftsgefühl, steht jedoch ständig unter der Einwirkung des individuellen Minderwertigkeitsgefühls und des von ihm ausgehenden Streben nach Macht.
Adler folgert daraus: „Das ‚Minderwertigkeitsgefühl‘ bedarf der ‚Kompensation‘ durch Hinwendung zur Gemeinschaft.“ Der Schlüssel zur Auflösung der Minderwertigkeitsgefühle liegt folglich in der Hinwendung zur Gemeinschaft. Für ihn ist das Gemeinschaftsgefühl, „mit den Augen eines anderen zu sehen, mit den Ohren eines anderen zu hören, mit dem Herzen eines anderen zu fühlen.“ Wenn wir dies tun, ermöglicht uns die Gemeinschaft – und nur diese – die Kompensation unserer Minderwertigkeitsgefühle und damit ein Leben ohne unser unglücklich machendes individuelles Streben nach Macht, hinzu Glück und Zufriedenheit – für uns und die Gemeinschaft.


